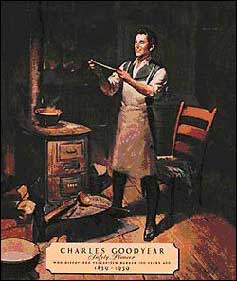von Jana Görs

In Blogbeitrag Killerphrasen haben wir über Aussagen gesprochen, mit denen vor allem außergewöhnliche Ideen im Keim erstickt werden. Innovationen benötigen jedoch außergewöhnliche Ideen. Allerdings fällt es uns schwer diese Ideen zu generieren und sie zu erkennen! Der Effekt ist, dass gute Ideen entweder erst gar nicht geboren oder bereits in der Keimphase erstickt werden.… Weiterlesen
von Jana Görs

Wieso ist dieser Vulkan ein Hinweis auf die Leichtigkeit Ideen zu produzieren? Dieses Rätsel – lieber Leser – wird am Ende dieses Beitrags aufgelöst. Bis dahin bin ich auf Ihre Fantasie gespannt!
In diesem Blogbeitrag möchte ich mir den Mythos vornehmen, dass nur Kreative gute Ideen entwickeln können.… Weiterlesen
von Graham Horton

Keith Sawyer hat in seinem Blog Creativity & Innovation das Innovationsbuch The Change Masters von Rosabeth Moss Kanter besprochen. In seinem Artikel Ten Rules for Stifling Innovation zitiert er zehn Management-Fehler, die Innovation in einem Unternehmen behindern:
- Regard any new idea from below with suspicion-because it’s new, and because it’s from below.
… Weiterlesen
von Jana Görs
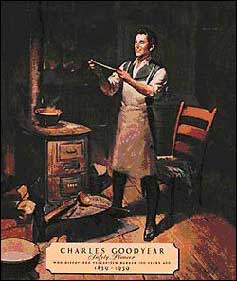
Auf der Suche nach Innovationserfolgen stieß ich auf eine echte Ideenverfechter-Geschichte des Erfinders des Vulkanisationsverfahrens, Charles Goodyear. Dieses Verfahren wird heute bei der Verarbeitung von Kautschuk angewendet, um ihn zu härten. Erst dadurch kann dieser als Hartgummi in Form von Gummistiefeln, Taucheranzügen, Reifen, u.v.m.… Weiterlesen
von Jana Görs

Letztens hielt ich ein provokantes Buch in den Händen; „The Corporate Fool“ von David Firth und Alan Leigh. Besonders spannend fand ich eine Seite mit echten Berufsbezeichnungen in Unternehmen. Betitelt werden diese Berufsbezeichnungen als Job Title to Die for:
- Troublemaker, US Department of Labor
- Chief Imagination Officer, Gateway 2000
- Minister of Progress, Aspen Tree Software
- VR Evangelist, Silicon Graphics Inc
- Director of Bringing in the Cool People, Netscape
- Director Mind & Mood, Foote, Cone and Belding
- Senior Creatologist, Polaroid
- Chief Growth Officer, Thomas Group
- Director of Intelligence, TBWA Chiat/Day
- Content Guy, AirMedia Inc
- Journey Manager, Barclays Bank
- Director of Fun, Sprint Paranet
Diese Berufsbezeichnungen müssen geradezu als wahre Provokateure im Unternehmen wahrgenommen werden.… Weiterlesen
von Graham Horton

Joyce Wycoff hat eine Top Ten-Liste von „Innovationskillern“ präsentiert. Dies sind Fehler, die ein Unternehmen begehen kann, und die das Innovationsmanagement erschweren. Die zehn „Killer“ lauten:
- Not creating a culture that supports innovation
- Not getting buy-in and ownership from business unit managers
- Not having a widely understood, system-wide process
- Not allocating resources to the process
- Not tying projects to company strategy
- Not spending enough time and energy on the fuzzy front-end
- Not building sufficient diversity into the process
- Not developing criteria and metrics in advance
- Not training and coaching innovation teams
- Not having an idea management system
Obwohl diese Liste inzwischen vier Jahre alt ist, stellen wir in unserer Arbeit fest, dass viele der darin beschriebenen Probleme nach wie vor weit verbreitet sind.… Weiterlesen